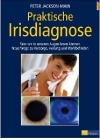Irisdiagnose
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann man neben wichtigen Hinweisen zur konstitutionellen oder erblichen Veranlagung auch akute Anzeichen der spezifischen Krankheitsdispositionen erhalten - und zwar längst bevor sich eine Erkrankung manifestiert. Die Irisdiagnose gehört zu den Verfahren der Hinweisdiagnostik und befähigt im Rahmen der heute üblichen Untersuchungsmethoden zu einer vollständigen naturheilkundlichen Diagnose, im Sinne der Ganzheitsschau von Körper, Geist und Seele. Sie ist imstande den richtigen Weg zu zeigen, wo man weiter suchen oder klinisch abklären lassen sollte.
Der Methode liegt die Vorstellung zugrunde, dass zwischen allen Körperteilen und Organen eine feste Nervenverbindung zur Regenbogenhaut (Iris) des Auges besteht. Krankheiten oder Störungen der Organe würden daher in verschiedenen Strukturen der Iris (Pigmentflecken, Streifen, Ringe) erkennbar sein. Entwickelt wurde die Methode um das Jahr 1880 von dem ungarischen Arzt und Homöopathen Ignaz von Péczely. Er bemerkte angeblich in den Augen einer Eule besondere Veränderungen, nachdem sie sich ein Bein gebrochen hatte.
Die Iris wird entweder mit einer Lupe betrachtet oder fotografiert. Der Therapeut schließt aus den auffälligen Strukturen in den Iris-Segmenten auf Krankheiten der entsprechenden Organe. Wichtigste Aufgabe der Irisdiagnose ist die Feststellung der Konstitution, wobei zwischen blauen (lymphatischer Typ) und braunen (hämatogener Typ) Iriden mit verschiedenen Untertypen unterschieden wird. Darauf baut sich immer eine Konstitutionstherapie auf (Behandlung mit physikalischen oder chemischen Mitteln, die eine Stärkung der Konstitution bewirken soll, um ein Wiederauftreten der gleichen Erkrankung beim Patienten zu verhindern).